|
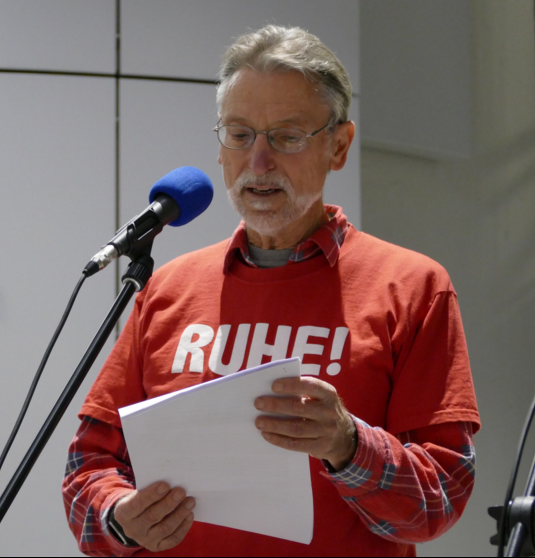
Guten
Abend ihr lieben Leute,
bei
mir wird es immer naturwissenschaftlich, obwohl ich gar kein Fachmann bin. Es
soll auch kein akademischer Vortrag werden sondern hoffentlich allgemeinverständlich
und natürlich kritisch.
Erst
vor wenigen Wochen (23.4.2019) fand in Frankfurt eine Diskussion des
Luftfahrtpresseclubs statt unter Einbindung von Vertretern der
Friday-for-future-Bewegung. Den jungen Leuten sollte der Schneid genommen
werden mit der Vision von angeblich klimaneutralem synthetischem Kerosin. Dies
war für mich Anlass, meine ohnehin kritische Einstellung zu hinterfragen und
zu untermauern. Dabei bin ich auf eine vielseitige Ausarbeitung zur Frage von
Ersatztreibstoffen gestoßen, die u.a. vom Zentrum für Luft- und Raumfahrt
initiiert wurde. Offenbar geht die Angst um, wie es weitergehen soll. https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/MKS/studie-biokerosin-ee-kerosin.pdf?__blob=publicationFile
Bemerkenswert
ist, dass man die Unmöglichkeit von wirtschaftlichem Fliegen mit Strom oder
reinem Wasserstoff einzusehen beginnt. Fliegen mit Strom geht ohnehin nur mit
Propeller, dazu kommen bei allem denkbaren Fortschritt immer schwer bleibende
Batterien, die das Landegewicht unerträglich erhöhen. Zu berücksichtigen
sind nicht nur die Emissionen des Fluggeräts sondern auch die Emissionen und
die hohen Verluste bei der Stromgewinnung, egal ob Braunkohle, Fotovoltaik
oder Wind- und Wasserenergie. Dass autonomes elektrisches Fliegen keine Lösung
sein kann, bewies vor 2-3 Jahren der Experimentalflug eines fragilen
Papiervogels im Tempo eines kernigen Radfahrers. Ein ganzes Jahr hat das
Geduldsspiel mit Warten auf freundliche Winde und gute Sonne gedauert. Denkbar
können allenfalls Kurzstrecken sein, wobei die Energiebilanz in der Addition
wesentlich schlechter ist als bei flüssigen Treibstoffen.
Grundsätzlich
bedarf heutiges Fliegen eines hohen Energieeinsatzes. Denn Flugzeuge bleiben
nicht von selbst in der Luft sondern müssen gegen den von der Geschwindigkeit
abhängigen Luftwiderstand in der Schwebe gehalten werden. Welche Energie
erforderlich ist, zeigt das Beispiel eines Jumbojets, der auf 100 km 1400 l
Kerosin verbraucht oder ca. 200 l in der Minute. Das schafft kein
Feuerwehrschlauch.
Eine
Alternative zu Kerosin wäre allenfalls Wasserstoff in flüssiger Form. Dieser
bedarf allerdings einer Ultratiefkühlung auf unter minus 253°C, wie dies in
der Raumfahrt unter völlig anderen Bedingungen praktiziert wird. Wasserstoff
lässt sich bei normaler Temperatur mit keinem Druck des Universums verflüssigen,
also ein riesiger Unterschied zu den Flüssiggasen Propan, Butan oder deren
Anwendung als Autogas. Für Wasserstoff verbleibt als Alternative zur
Ultratiefkühlung nur die Gasform in schweren Hochdruckflaschen. Unabhängig
vom Gewicht wären das bei einer Havarie Bomben.
Was
verbleibt also als Ersatz für das endliche fossile Kerosin wenn Batterien und
Wasserstoff ausscheiden? Die schlechteste Lösung wäre Biokerosin vom Acker
oder Palmöl von niedergebrannten Regenwäldern. Kennen wir längst vom
Alkoholzusatz im Benzin und Rapsöl im Diesel. Also Tank anstatt Teller. So
weit sind wir schon. Nach meinem Informationsstand werden fast 90% der
deutschen Agrarfläche missbraucht für den Anbau von Viehfutter für den
Fleischexport und Energiepflanzen in Gestalt von Zuckerrüben, Raps und Mais.
Gerade jetzt ist das ganze Land flächendeckend gelb. Das ist nicht schön
sondern beunruhigend. Längst wird der Großteil unserer Nahrungsmittel
importiert und zunehmend unter hohem Energieeinsatz eingeflogen.
Die
Zauberformel lautet synthetisches Kerosin auf der Basis von elektrolytisch
gewonnenem und dann zu Methan karboniertem Wasserstoff. Allerdings ist die
Herstellung von Methan und dessen Weiterverarbeitung sehr teuer und
energieintensiv. Anlagen im großen, industriellen Stil gibt es bislang nicht,
nur Pilotanlagen. Und die Methanisierung hat noch einen Nachteil. Man braucht
konzentriertes Kohlendioxid in Mengen.
Welche
Mengen erforderlich wären, macht der tägliche Treibstoffbedarf von 15
Millionen Litern Kerosin alleine durch Fraport deutlich. Fraport verbraucht
mehr Treibstoff als das gesamte Hessen. Im Nahbereich von Fraport werden täglich
mehr als 1 Million Liter Kerosin zu einem sich absenkenden Giftcocktail
verblasen, mehr als der gesamte Bodenverkehr hervorbringt. Nach einer Veröffentlichung
des Umweltamtes der Stadt Frankfurt sollen über 40% der Bodenbelastung der
Region vom Flugbetrieb stammen.
Zwingende
Voraussetzung, auf dem Wege der Wasserstoffelektrolyse als Grundlage zur
chemischen Weiterverarbeitung ist die vollständige Umstellung der
Stromversorgung auf regenerative Energie und das bei weiterhin steigendem
Strombedarf, nicht nur für die Vision der Elektromobilität. Es macht keinen
Sinn, Kerosin mit Hilfe regenerativer Energie zu synthetisieren und diesen dem
Netz vorzuenthalten. Wie viele Windmühlen müssten aufgestellt und welche Flächen
mit Fotovoltaik müssten der Landwirtschaft zur Befriedigung des Luftverkehrs
entzogen werden.
Wie
soll die Kerosinsynthese funktionieren? Basis ist natürlich Strom, egal wo
dieser herkommt oder andernorts fehlt. Die erste Stufe ist die elektrolytische
Spaltung von flüssigem Wasser oder Wasserdampf in Wasserstoff und Sauerstoff.
Der so mit erheblichem Energieeinsatz gewonnene Wasserstoff muss dann mittels
CO2 zu Methan karboniert und dann wie bei der Kohleverflüssigung zu
Kriegszeiten weiterverarbeitet werden. Vor allem muss die gesamte im
Endprodukt steckende Energie zuerst einmal im Prozesswege eingebracht werden.
Und alle Stufen der Umwandlung sind mit Energieverlusten verbunden. Nimmt man
Strom aus Braunkohle als Primärenergie ist der Wirkungsgrad des Endprodukte
weitaus schlechter als beim direkten Einsatz von fossilem Flüssigtreibstoff
im Triebwerk.
Auch
das Schönrechnen, dass bei der Karbonierung der Atmosphäre so viel CO2
entnommen wird, wie bei der Verbrennung in den Triebwerken entsteht, geht
nicht auf. Das Spurengas CO2 aus der Luft abzutrennen, ist schwierig und
energieaufwendig. Es verbleiben chemische Prozesse, bei denen CO2 freigesetzt
wird, dazu gehören sogar die beim Bierbrauen entstehenden Gärgase sowie die
bei der thermischen Öldestillation anfallenden Verbrennungsgase. Neben
Kohlekraftwerken mit 50% des weltweiten CO2-Ausstoßes sind die Drehöfen der
Zementwerke als Großemittenten mit 8% des CO2-Anfalls beteiligt. Die
Kohlekraftwerke sollen aber bald der Vergangenheit angehören. Verbleiben als
Großemittenten nur die Zementöfen. Deren Verbrennungsabgase sind aber
chemisch sehr belastet und keineswegs eine ideale Quelle. Als Massenlieferant
verbleibt am ehesten das Abfallprodukt CO2 bei chemischen Prozessen und beim
gewöhnlichen Kalkbrennen. Das Rohmaterial Kalkstein oder chemisch
Kalziumkarbonat zerfällt bereits unter mäßiger Hitzeeinwirkung in
Kalziumoxid und Kohlendioxid. Ob solche Mengen an CO2 anfallen, wie zur
massenhaften Synthese des Zwischenprodukts Methan erforderlich sind, darf
bezweifelt werden.
Die
Fixierung darauf, dass im Flugbetrieb nur so viel CO2 freigesetzt wird, wie
der unteren Atmosphäre entzogen wird, lässt unberücksichtigt, dass die
Freisetzung in großer Höhe 3 - 4 x klimawirksamer ist als am Boden. Es kann
in Flughöhe keinen Abbau durch Pflanzenassimilation oder durch ozeanische
Aufnahme geben. Dazu kommt noch das Verbrennungsprodukt Wasser als
Wolkenbilder mit Reduzierung der Ausstrahlung. Und ähnlich wie bei dem sich
aus vielen Fraktionen zusammensetzenden Mischdestillat Kerosin entsteht auch
bei künstlich hergestellten Kohlenwasserstoffmolekülen neben CO2 und Wasser
ein ganzer Giftcocktail verschiedener Reaktionsprodukte und jede Menge
Ultrafeinstaub als Kondensationskeime. Absolut gleich bleibt der Ausstoß an
Stickoxiden, die sich unter Reinluftbedingungen langsamer abbauen als in
Bodennähe. Nur in Bodennähe ist durch Entnahme oder Verwertung von CO2 die
Bilanz besser, alle anderen Schadwirkungen bleiben gleich. Und für die
Entstehung von Stickoxiden ist nicht der Energieträger entscheidend sondern
Druck, Hitze und Luftüberschuss bei der Verbrennung. Synthesekerosin ist
keineswegs klimaneutral, wie man sich vormacht oder den Bürger weismachen
will.
Auf
jeden Fall wird Synthesetreibstoff eine teure Angelegenheit. Nicht nur Fliegen
wird teuerer, auch das gesamte Leben und damit wird der Raum, sein Geld zu
verfliegen, schon mittelfristig stagnieren oder sinken. Und der
Synthesetreibstoff steht dann in Preiskonkurrenz zu dem nicht weniger
bedenklichen Heizöl und dem fossilen Kerosin, das wegen der endlichen Vorräte
sicherlich nicht auf Dauer zu Schnäppchenpreisen verfügbar sein wird. Vor
diesem Hintergrund ist der Ausbauwahn von Fraport ein wirtschaftlicher
Kriminalfall. Nachdem der Flugplatz Stuttgart ganz aktuell zum 1.7.2019 eine
massive Erhöhung der Landegebühren für laute Maschinen durchaus gängiger
Typen angekündigt hat, droht hier eine Abwanderung zum lärmfreundlichen
Fraport.
Alle
derzeit als Utopie gehandelten Überlegungen erinnern an Singen im dunklen
Keller. Zu viele Bedingungen müssen gleichzeitig erfüllt sein, als dass
deren Eintritt wirklich realistisch sein kann.
Die
Zukunft gehört dem Lastesel Zeppelin, der dank seiner großen Oberfläche möglicherweise
außerhalb polarer Bereiche per Fotovoltaik autark sein kann, allerdings
langsam und wetterempfindlich.
Naturgesetze
kann man weder politisch noch juristisch aushebeln, auch wenn Entscheidungsträger
immer noch an das Perpetuum
mobile glauben.
Hartmut Rencker, Mainz
|